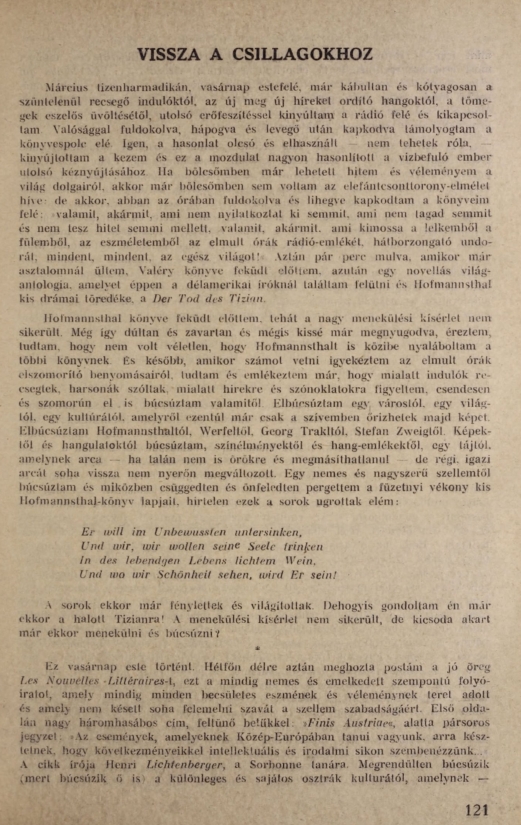János Vajda d. J.: Zurück zu den Sternen
Am dreizehnten März, am Sonntag gegen Nachmittag, als mein Kopf schon von der ständig ratternden Marschmusik, von den schrillen Tönen immer neuer Nachrichten, von dem hysterischen Gebrüll der Menschenmengen schwirrte, griff ich mit letzter Anstrengung zum Radio und schaltete es aus. Mit dem Gefühl zu ersticken, nach Luft schnappend taumelte ich zum Bücherregal. Sicher ist der Vergleich billig und abgedroschen – ich kann nichts dafür –, doch als ich meine Hand ausstreckte, hatte diese Bewegung vieles gemeinsam mit der letzten Bewegung eines Ertrinkenden. Sollte ich bereits in der Wiege einen Glauben und eine Meinung über die Dinge der Welt gehabt haben, so hielt ich bereits in der Wiege nichts von Elfenbeinturm-Theorie – doch da, in jener Stunde haschte ich hastig nach meinen Büchern: Nur irgendetwas finden, egal, was, was nichts offenbart, was nichts leugnet und kein Glaubensbekenntnis macht; nur irgendetwas, egal, was, was mir die Erinnerungen an die Radiosendungen der letzten Stunden, den fürchterlichen Ekel, alles, alles, die ganze Welt, aus der Seele, aus den Ohren, aus dem Gedächtnis löscht! Dann, einige Minuten später, als ich schon am Schreibtisch saß, lag Valérys Buch vor mir; danach griff ich nach einer Weltanthologie aus Erzählungen, die ich gerade bei den südamerikanischen Schriftstellern aufschlug, und wieder weiter nahm ich das dramatische Fragment von Hofmannsthal, Der Tod des Tizian in die Hand.
Vor mir lag das Buch von Hofmannsthal, der große Fluchtversuch scheiterte also. Selbst in diesem aufgewühlten und verstörten Zustand und doch schon einigermaßen beruhigt fühlte, ja wusste ich, dass es kein Zufall gewesen sein kann, Hofmannsthals Buch zusammen mit den anderen Büchern aufgegriffen zu haben. Und später, beim Versuch, den tristen Eindrücken der vergangenen Stunden Rechnung zu tragen, wusste ich und konnte mich daran erinnern, dass ich, während die Marschmusik und die Posaunen dröhnten, während ich den Nachrichten und Reden zuhörte, still und traurig von etwas Abschied nahm. Ich nahm Abschied von einer Stadt, einer Welt, einer Kultur, deren Bild ich nun nur noch im Herzen tragen werde. Ich nahm Abschied von Hofmannsthal, von Werfel, von Georg Trakl, von Stefan Zweig. Ich nahm Abschied von Bildern und von Stimmungen, von Farberlebnissen und Klangerinnerungen, von einer Landschaft, deren Gesicht sich – wenn vielleicht nicht für immer, aber ihr altes, wahres Gesicht nie mehr zurückgewinnend – geändert hat.
[…]
Dies geschah am Sonntagabend. Am Montagmittag erhielt ich dann mit der Post die guten alten Les Nouvelles Litteraires, diese Zeitschrift, die immer edlen und erhabenen Prinzipien folgte, die immer allen ehrlichen Gesinnungen und Meinungen Raum gewährte und die sich nie zögerte, sich für die geistige Freiheit einzusetzen. Auf der ersten Seite stand ein riesiger Dreikolumnentitel mit auffälligen Buchstaben: »Finis Austriae«, darunter eine kurze Notiz. Die Ereignisse, deren Zeugen wir in Mitteleuropa sind, bewegen uns dazu, dass wir ihren Konsequenzen auf intellektueller und literarischer Ebene begegnen.
Der Verfasser des Artikels ist Henri Lichtenberger, Professor an der Sorbonne. Zutiefst bewegt nimmt er Abschied (denn auch er nimmt Abschied) von der besonderen und bezeichnenden österreichischen Kultur, zu deren kompromisslosesten Vertretern – wie er schreibt – Hofmannsthal zähle und die nun fast hoffnungslos von der germanischen Sintflut überschwemmt sei (»… ce déluge qui vient de niveler un nouveau coin de l’Europe bouleversée«). Der Artikel vergegenwärtigt feinzügig das Porträt des großen österreichischen Dichters, der Österreicher war, ja sogar Wiener, ein großer Erträumer des Weltfriedens, der fest an der intellektuellen Vereinigung Europas glaubte und der von den neuen Herren der Macht für keinen guten Deutschen gehalten wird.
[…]
Dass diese alte Maxime, diese alte Wahrheit, von den ausgezeichneten französischen Professoren immer wieder genannt und betont wird, ist auf keinen Fall verlorene Mühe. Besonders jetzt, wo die Begriffe durch die verwirrten Geschehnisse wieder durcheinandergebracht werden und wo wir auch in der Literatur Ereignisse erblicken, über deren Ausgang wir uns nichts vormachen können. Natürlich sind wir nicht besorgt, dass die Leser im Rausch der neuen Zeiten Goethe Grillparzer vorziehen werden, und dass der abtrünnige Gerhart Hauptmann beliebter wird als zum Beispiel Franz Werfel: Es sind ganz andere Lektüren, vor deren zweifelhafter und schädlicher Wirkung wir um die österreichische Leserschaft bangen. Aber ist das denn nicht schon alles egal? Kann noch all das, was aus den Schriften von Goethe oder Hauptmann herausgelesen wird, Gewicht und Wirkung haben? Kann der Geist noch seine Kraft zeigen dort, wo sich ganz andere Worte verbreiten und wirken? Hat es für den Dichter nach alldem noch einen Sinn, seine Feder zu ergreifen?
[…]
Wer traut sich noch heutzutage, in poetischen Lichtjahren zu sprechen und zu denken? […] Die Dichter schwanken erschüttert – wie so oft in den letzten zwei Jahrzehnten –, ob sie nicht lieber zum Besingen der Jahreszeiten und zu den Sternen zurückkehren sollen.
[…]
Aber in der jüngsten Vergangenheit widerfuhr uns erneut etwas, nein, in jeder Stunde widerfährt uns erneut etwas, was die alte Frage wachhält, erneut auflodern lässt, ob die Kunstwerke noch einen Sinn haben, ob der Dichter verpflichtet ist, an seinem Platz zu bleiben, zu rufen, zu führen, Glauben zu bekennen, Ja zu sagen, Nein zu sagen, oder aber wirklich zu den Sternen zurückkehren und, sein Kopf an der Brust seiner Geliebten ruhend, zusehen soll, wie die Erde im eigenen bitteren Saft schmort.
An jenem Sonntagabend, bei diesem fast körperlichen Gefühl der Erschütterung und des Widerstrebens, suchte ich einen Moment lang auch selbst nach einer Art Lethe-Wasser, aber eben nur einen Moment lang. Nur bis ich das „fluchtartig“ aufgegriffene Buch öffnete: Und siehe da, selbst die reine Lyrik im Fragment des jungen Hofmannsthal konnte ich mit der Gegenwart identifizieren! Soll also der Dichter zu den Sternen zurückkehren? Die Welt ist unbarmherzig, grausam und feindlich. Er soll also zurückkehren! Aber nicht um der Sterne willen! Er sehnt sich nach Ordnung? Dann soll er der Ordnung der Gewalt und der böswilligen Parolen den Rücken kehren und sich der ewigen und unerschütterlichen Ordnung der Sterne zuwenden! Er sehnt sich nach Gesetzen? Dann wende er sich von den Gesetzen der Dunkelheit und Barbarei ab und richte seinen Blick auf das Gesetz des Weltalls! Er sehnt sich nach Rhythmus und Regelmäßigkeit? Dann wende er sich von dem Rhythmus der marschierenden Füße, der rasselnden Stiefeln und der Kommandorufe ab und richte seinen Blick auf den siegreich wiederkehrenden Rhythmus der geheiligten Jahreszeiten! Will er von den Blumen schreiben? Dann schreibe er von den Blumen! Von dem Schneeglöckchen, das schon im eisigen Februar aufgeht und blüht, und von dem Immergrünen, das dem Winter trotzt! Ist das ein Klischee? Ja, das ist es. Er tue es aber nicht um der Sterne, nicht um der Blumen und nicht um der Jahreszeiten willen! Sondern um Kraft zu schöpfen und um auf etwas hinweisen zu können! Um etwas zum Symbol erheben zu können im Zeitalter schändlicher und verhasster Symbole. Um hinausrufen zu können, dass nicht alles verloren ist, dass der Geist doch lebt! Kann er das nicht mehr sagen, nur noch mit Hofmannsthal? Dann sage er es mit Hofmannsthal:
Er will im Unbewußten untersinken,
Und wir, wir sollen seine Seele trinken
In des lebendgen Lebens lichtem Wein,
Und wo wir Schönheit sehen, wird Er sein!
Deutsch von Bernadett Modrián-Horváth
Vissza a csillagokhoz. In: Literatura. Beszámoló a szellemi életről. A Lafontaine-Társaság, a Magyar Irodalmi és Művészeti Szövetség, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Kulturszövetség, a Vajda János-Társaság és az UMBE Irodalmi Közlönye. Jahrgang XIII, 15.04.1938, 121–123.