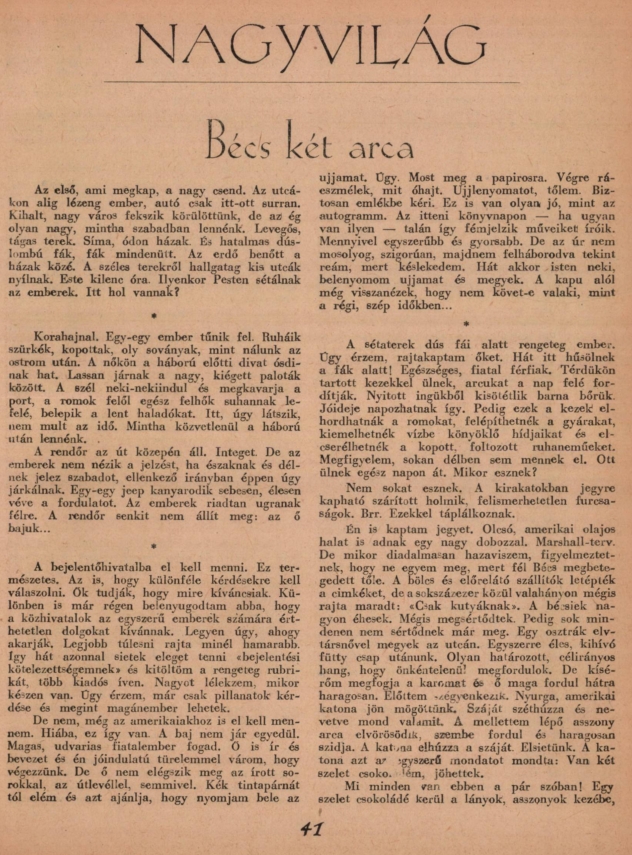Die zwei Gesichter von Wien
- Autor*in: Anna Balázs
- Übersetzt von: Bernadett Modrián-Horváth
- Publikationsdaten: Ort: Budapest | Jahr: 1947
- Erschienen in: Csillag
- Ausgabe-Datum: 1947
- Sprachen: Deutsch
- Originalsprachen: Ungarisch
- Gattung: Feuilleton
Kommentar:
Anna Balázs (1907–1998) arbeitete als Mechanikerin, wandte sich aber Anfang der 1940-er-Jahre zunehmend der Publizistik und der Literatur zu. Balázs war Mitarbeiterin und Redakteurin der Népszava (Zeitungsorgan der Sozialdemokratie), schloss sich dem kommunistischen Widerstand an und unterstützte den Machtwechsel von 1947. In ihren Romanen bearbeitete sie politische, die Arbeiter*innen- und Frauenbewegung betreffende Sujets.
Der Artikel enthält Impressionen von einem Aufenthalt in Wien, der im Sommer 1947 stattgefunden haben könnte und in der Septembernummer der Zeitschrift Csillag, unmittelbar nach den Parlamentswahlen erschienen ist, die in Ungarn die kommunistische Herrschaft einleiteten. Die im Titel genannten beiden Gesichter der Stadt spiegeln zum einen die seit Kriegsende politisch komplexe Situation Österreichs als in Besatzungszonen aufgeteiltes, kriegsbedingt armes Land, zum anderen das Aufleben dieses Landes mit ersten Anzeichen einer kapitalistischen Wirtschaft. Der Bericht ist dichte Beschreibung von Straßenszenen, Situationen in den Behörden, im Theater, im Kino sowie Kommentar einer Fabrikversammlung, an der die österreichische politische und soziale Situation mit der ungarischen verglichen wird. Besonders interessant ist Balázs‘ Beschreibung eines Besuchs in einer Fabrik bei Zistersdorf, aus dessen Anlass die Autorin die Entwicklung der Produktionsverhältnisse und den angehenden Wohlstand des Landes mit dem versteckten Lob des sowjetischen Einflusses verbindet.
Im Beitrag wechseln anschauliche Bilder des Fremden ab, deren ideologische Unterfütterung für ein Wechselspiel von Lob und Kritik sorgt und den Text der kritischen Analyse der politisch bedingten Zu- bzw. Abneigung eröffnet.
Übersetzung
Anna Balázs: Die zwei Gesichter von Wien
Das erste, was einen ergreift, ist die tiefe Stille. Es sind kaum Menschen auf den Straßen, nur hie und da brummen Autos. Um uns herum liegt eine große, menschenleere Stadt, aber der Himmel ist so weit, als wären wir im Freien. Luftige, geräumige Plätze. Schlichte, altmodische Häuser. Und riesige Bäume mit dichtem Laub, Bäume überall. Der Wald ist in die Stadt hineinwachsen. In die geräumigen Plätze münden ruhige kleine Straßen. Es ist neun Uhr nachts. Zu dieser Zeit gehen die Leute in Pest spazieren. Wo sind sie hier?
*
Früh morgens. Etliche Menschen erscheinen. Sie sind so dünn wie die Menschen bei uns nach der Belagerung. Ihre Kleidung ist grau, abgewetzt, die Frauen tragen veraltet wirkende Vorkriegsmode. Sie wandeln langsam zwischen den großen, ausgebrannten Palästen. Der Wind wirbelt den Staub auf, und ganze Staubwolken gleiten von den Trümmern herab und bedecken die unten wandelnden Gestalten. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Als wäre der Krieg gerade vorbei.
[…]
*
Man muss zum Meldeamt gehen. Das ist selbstverständlich. Genauso, dass man verschiedene Fragen beantworten muss – sie werden schon wissen, was sie erfahren wollen. Jedenfalls habe ich mich längst damit abgefunden, dass die Behörden Dinge verlangen, die für den Normalbürger nicht nachvollziehbar sind. Machen Sie, was Sie wollen. Am besten bringt man es so schnell wie möglich hinter sich, also beeile ich mich sofort, meiner „Meldepflicht“ nachzukommen und die vielen Rubriken auf mehreren Seiten auszufüllen. Ich atme tief durch, als es soweit ist, mit dem Gefühl, mich in wenigen Augenblicken wieder in eine Privatperson verwandeln zu können.
Dem ist aber nicht so, ich muss auch noch zu den Amerikanern gehen. Da kann man halt nichts machen. Ein Unglück kommt selten allein. Ich werde von einem großen, höflichen jungen Mann begrüßt, auch er schreibt, er führt mich hinein, und ich warte mit gutmütiger Geduld darauf, dass wir fertig sind. Aber er gibt sich nicht zufrieden, weder mit den geschriebenen Zeilen noch mit dem Pass, mit überhaupt nichts. Er schiebt mir ein blaues Stempelkissen vor die Nase und schlägt vor, meinen Finger hineinzudrücken. Also. Und nun aufs Papier. Endlich wird mir klar, was er wünscht. Einen Fingerabdruck, von mir. Er will ihn bestimmt als Souvenir haben, der ist ja genauso gut wie ein Autogramm. In der Buchmesse, falls es hier überhaupt so etwas gibt, kennzeichnen die Autoren ihre Werke vielleicht auf diese Weise. Ist ja viel einfacher und schneller. Aber der Herr lächelt nicht, er sieht mich streng, fast entrüstet an, weil ich zögere. Also Augen zu und durch: Ich drücke meinen Finger drauf und gehe. Unter dem Tor schaue ich noch zurück, um zu sehen, ob mir jemand folgt, wie in den guten alten Zeiten…
*
Unter den üppigen Bäumen der Promenaden tummeln sich viele Menschen. Ich habe das Gefühl, sie erwischt zu haben. Hier sind sie also und erfrischen sich unter den Bäumen! Gesunde, junge Männer. Sie sitzen mit den Händen auf den Knien, das Gesicht der Sonne zugewandt. Ihre braune Haut scheint durch ihre offenen Hemden hervor. Sie dürften schon eine ganze Weile in der Sonne liegen. Dabei könnten diese Hände die Trümmer wegräumen, die Fabriken aufbauen, die ins Wasser stürzenden Brücken herausheben und die abgenutzten, geflickten Kleidundsstücke austauschen. Mir fällt auf, dass viele Leute auch mittags nicht weggehen. Sie sitzen den ganzen Tag dort. Wann essen sie?
Sie essen ja nicht viel. In den Schaufenstern liegen getrocknete Waren, nicht zu identifizierende, skurrile Dinge, die gegen Lebensmittelkarten angeboten werden. Brrr. Davon ernähren sie sich.
Auch ich habe Lebensmittelkarten bekommen. Man gab mir dazu noch eine große Dose billigen amerikanischen Fisch. Marshallplan. Aber als ich ihn triumphierend nach Hause bringe, werde ich gewarnt, ihn bloß nicht zu essen, weil halb Wien davon krank ist. Die klugen und vorsichtigen Lieferanten rissen die Etiketten ab, aber einige der Hunderttausende blieben auf den Dosen kleben: „Nur für Hunde“. Die Leute in Wien sind sehr hungrig. Dennoch waren sie beleidigt. Dabei finden sie vieles nicht mehr beleidigend. Ich gehe mit einer österreichischen Genossin die Straße entlang. Plötzlich ertönt ein scharfer, herausfordernder Pfiff hinter uns. Der Klang ist so fest, so provokativ, dass ich mich unwillkürlich umdrehe. Doch meine Begleiterin nimmt mich am Arm, und dreht sich verärgert selbst nach hinten. Sie schämt sich vor mir. Ein großgewachsener amerikanischer Soldat kommt hinter uns her. Er öffnet seinen Mund, lacht und sagt etwas. Die Frau neben mir läuft rot an, dreht sich mit dem Gesicht zu ihm um und beschimpft ihn wütend. Der Soldat verzieht den Mund. Wir eilen fort. Der Soldat hatte den einfachen Satz gesagt: „Ich habe zwei Stück Schokolade, ihr könnt mitkommen.“
Was alles steckt in diesen wenigen Worten! Ein Stück Schokolade wird in die Hände von Mädchen und Frauen gedrückt, die sie mit in ihre Jeeps, in ihre Cafés, in ihre großen Häuser nehmen. Über dem Café steht geschrieben, wer es besuchen darf. Österreicher dürfen es nicht. Wo ein Amerikaner sitzt, darf kein Österreicher hingehen. Aber sie sehnen sich auch nicht danach. Diese Mädchen, die in der Stadt als Chocolate Girls bekannt sind, schon. Manchmal bieten sich Mutter und Tochter vor den Toren an. Sie erwarten alles von anderen und sind nicht wählerisch. Die großen Paläste stehen schweigend da, ihre blinden Augenhöhlen starren auf die adretten, eleganten Amerikaner. Was sie so bestaunenswert macht: Ihre Taschen strotzen von Dollar.
*
Zeitungsverkäufer bieten ihre Waren in großen Zelten an. Vor ihnen laufen drei oder vier schäbige Männer herum, die lautstark für ihre Zeitungen werben. Der Reichtum des Zeitungskiosks ist jedoch nicht auf die große Zahl der Zeitungen zurückzuführen. Es gibt eine Menge Trivialliteratur. Ich zähle nach. Genau vierzig verschiedene Arten von Trivialausgaben schmücken das Zelt mit grellen rotgelben Deckblättern. Ein hässlicher Blumengarten. Die Verleger sind wie gelähmt und warten darauf, dass sich die Zeiten ändern, aber die Geschäftstüchtigen wissen, wo die Gewinne liegen. Der Schund verkauft sich gut, innerhalb einer halben Stunde bleiben vier Kunden vor dem beobachteten Verkäufer stehen. Sie zeigen mit bestimmter Geste auf das gewünschte Buch hin und der Kauf ist abgeschlossen. In manchen großen Buchhandlungen gibt es keinen einzigen Besucher, und derart viele Kunden sind äußerst selten. Das hier ist ein besseres Geschäft.
*
Die Schaufenster sind ärmlich. Wenn ich an Pest denke, lächle ich voller Stolz. Das hier? Aber bitte! Unsere können sich sehen lassen! Die österreichischen Arbeiter schweigen tief. Sie sprechen über Ungarn wie über den Himmel. „Sie haben leicht reden“, sagt ein kleiner, älterer Mann, „Sie haben eine Volksdemokratie dort.“ Und dieses Wort hat hier den Klang eines Gebets. Sie sagen es voller Ehrfurcht. Ich schaue den Mann an, seine eingefallenen, tiefsitzenden Augen verraten vieles, was das Schamgefühl nicht über die Lippen lässt. Der Saal um mich herum wird voller und voller. Es ist die Kollektivversammlung eines Großbetriebs. Sozialdemokraten und Kommunisten kamen zusammen, um die Berichte ihrer Kollegen zu hören, die Ungarn besucht hatten. Während wir auf den Beginn warten, erfahre ich eine Menge. Die Gewerkschaft sei gegen sie, und die pro-amerikanische Führung der Sozialdemokratischen Partei habe gedroht, ihre Mitglieder auszuschließen, falls sie an der Reise teilnehmen. Aber es gab auch solche, die neugierig waren, was von den widersprüchlichen Nachrichten, die die österreichische Hauptstadt von sich gab, stimmte: die Erzählungen der geflohenen Ungarn oder die Masse der ankommenden Pakete? Die Führung der Sozialdemokratischen Partei begrüßt diese Wahrheit nicht. Der österreichische Arbeiter, dessen Lohn in seiner Hand schrumpft, wenn er ihn erhält, sollte die Wahrheit besser nicht erfahren. Und auch unter den Ungarnreisenden befinden sich manche, die bereit sind, ihrer Partei einen „Dienst zu erweisen“, indem sie die Sicht auf die Dinge vernebeln.
Im Saal wird es still. Eine Frau geht auf das Podium. Eine Sozialdemokratin. Ihre Notizen stecken in einem dicken Notizbuch. Sie blättert die Seiten schnell um. Dann werden Daten genannt, die eine tiefe Stille hervorrufen, und ich glaube, ich kann meinen Ohren nicht trauen. Sie spricht mit klingender, selbstbewusster Stimme: „Ein ungarischer Arbeiter verdient vier- bis fünfhundert Forint. Ein Kilo Würstchen kostet einhundertzwanzig Forint. Für ein Paar Schuhe bezahlt man fünfhundertsechzig, für ein Paar Halbstrümpfe sechsundzwanzig Forint.“
Das Publikum ist erstaunt. Ist dies der Arbeiterhimmel? Als der Preis von Würstchen genannt wird, ertönt Spott: Und was essen dann die Arbeiter? Denn bei diesen Preisen…!
Aber die Rede geht weiter. Es folgt eine Reihe von Produktionszahlen, in einem so selbstbewussten Ton, dass ich nicht wagen würde, mit annähernder Sicherheit zu sagen, was ich weiß, obwohl das wahr ist.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich wende mich an meine Sitznachbarin und sage ihr, dass kein einziges Wort von dem, was die feurige Dame sagt, wahr ist. – Aber sie hat Notizen! – Trotzdem stimmt es nicht. Ich zeige ihr meine Schuhe und Kleidung und nenne den Preis. Die Dame redet, aber ich setze mich durch. In kürzester Zeit werden alle meine Worte verbreitet und das Publikum glaubt mir. Die Rednerin spürt, dass sich die Stimmung geändert hat. Sie spricht noch lauter, aber jetzt kann sie schon schreien. Als der ältere Arbeiter, der nach ihr aufsteht, zu sprechen beginnt, wird er beklatscht. Er spricht über den Glauben und die Kraft der ungarischen Arbeiter. Über den Wettbewerb. Außerdem erzählt er, in den Theaterlogen, auf den Bühnenbildern säßen nicht, wie früher, Fürsten, Grafen und Industrielle, sondern Arbeiter. Nie sei der arbeitende Mensch so wertgeschätzt gewesen wie in einer Volksdemokratie… Er sagt uns, dass das ungarische Volk tatsächlich zu kämpfen habe, aber sein Weg sei aufwärtsgerichtet. „Sogar die Luft ist dort anders.“
Die Versammlung endet mit dem Beitrag eines leitenden Arbeiters: „Dies sind große Erfolge der Arbeitergemeinschaft. Das werden wir uns für immer merken.“
*
Ich sitze in einem Kinosaal. Mrs. Miniver. Alle Plätze sind besetzt. Die Kinos in der Innenstadt sind voll. Unter den Zuschauern befindet sich kein einziger Mensch im Arbeitsanzug. Ich sehe mir die hineinströmende Menge an.
Der Film läuft.
Das Publikum brüllt.
Es ist unverständlich. Sind die verrückt geworden, dass sie so etwas wagen? Es ist alles so fremd, dass ich erst jetzt merke, dass ich wirklich in ein fremdes Land geraten bin. Im Film taucht ein deutscher Soldat auf, er betritt ein feindliches Haus und richtet seine Waffe auf eine Frau, während sie ihm zu essen gibt. Das Publikum ist in Aufruhr. Laute, raue Stimmen schreien. „Eine Schweinerei ist das! Pfui Teufel! Der deutsche Soldat ist ein Held!“ Manche springen sogar auf.
(Ich denke an einen Maiaufmarsch, als ich zum ersten Mal den fernen Klang einer Blaskapelle hörte, der die tiefe Stille der morgendlichen Straßen durchbrach. Es kam eine lange Kolonne von Arbeitern. Sie marschierten schweigend unter ihren Fahnen. Die Polizei begleitete den Zug von beiden Seiten. Man konnte nicht wissen, wen oder was sie beschützten. Jetzt kommt mir für einen Moment der Gedanke, dass sie vielleicht darauf bedacht waren, diesen Nazi-Abschaum nicht von den Demonstranten wegfegen zu lassen. Denn das sind diese Stimmen im Zuschauerraum: die Stimmen der Nazis. Natürlich bauen sie nichts, natürlich erwarten sie alles von anderen! Am Maifest nahmen auch Amerikaner teil. Sie stellten ihre Autos und ihre bewaffneten Männer vor die Gebäude der kommunistischen Partei. In Wells standen zwei amerikanische Soldaten zu beiden Seiten des kommunistischen Redners. Sie taten nichts, nur der eine fummelte leise an einem Paar Handschellen herum und der andere an seinem Revolver. Die ganze Zeit über. Der Redner ließ sich nicht einschüchtern und sprach über die heikelsten Themen in Bezug auf Amerika. Währenddessen klapperten die Handschellen neben ihm und der geladene Lauf der Pistole drehte sich ab und zu gegen ihn.)
[…]
*
Zistersdorfer Ölfelder. Hunderte von Ölbrunnen bedecken Hunderte von Quadratkilometern. Wie alles andere ist auch dieser Bereich in Zonen aufgeteilt. In der russischen Zone sind viertausend Arbeiter beschäftigt. Zuvor hatten die holländischen, britischen und amerikanischen Eigentümer es fast ungenutzt gelassen, die Produktion war nicht wichtig: Sie kauften es, damit es nicht mit ihrem eigenen Öl konkurrierte. Es wurde während des Krieges von der deutschen Kriegsmaschinerie ausgebaut. Ukrainische und polnische Zivilisten und Kriegsgefangene schufteten hier unter Zwangsarbeit. Die Brunnen blieben unversehrt erhalten, weil die Russen so plötzlich kamen, dass die Nazis keine Zeit hatten, sie zu sprengen.
Seitdem haben sich die Dinge weit entwickelt. Es wird mehr produziert mit weniger Arbeitskräften. Hier sehe ich zum ersten Mal, dass österreichische Arbeiter auch bauen können und gerne arbeiten würden, wenn jemand die Produktion in Gang setzen würde. (Von ihrer Regierung, die im Sold der Imperialisten steht, können sie nichts erwarten.) Jeder Betrieb in Zistersdorf hat einen eigenen Club, einen Sport- und Kulturverein und eine Bibliothek. Stolz präsentiert man ein Kino mit vierhundert Plätzen, das die Österreicher selbst gebaut haben, während die Russen das Material dazu lieferten.
Und das Gehalt? Besser als überall sonst. Sie erhalten auch Lebensmittel, ein Kilogramm Zucker pro Person, Fleisch, Mehl und Gemüse. Mittagessen für einige Groschen in der Betriebskantine. Ich esse mit ihnen zu Mittag. Man bekommt eine so große, tiefe Schüssel fettige Gulaschsuppe mit Fleisch, dass der riesige Krapfen danach kaum noch abrutschen will, obwohl er reichlich mit Marmelade übergossen wurde.
Eine Flut von Stellenbewerbern strömt hierher aus dem ganzen Land, staubig, müde, hungrig. Wenn sie erfahren, dass sie nicht zugelassen werden, gehen sie verzweifelt weg. Die sowjetischen Betriebe haben einen guten Ruf. Aber es nützt nichts: Eine einzige Zone kann nicht die Arbeitnehmer eines ganzen Landes mit Arbeit versorgen. Die anderen Bereiche scheinen ausgestorben zu sein. Die Fabriken sind baufällig, Maschinen sind nirgends zu finden.
*
Am Abend wird die Stadt ruhiger. Doch jetzt hört man kräftige, klingende Stimmen rufen. Sie kommen aus der Richtung des griechischen Botschaftsgebäudes. Studenten drängen sich vor ihm, Hunderte von jungen Menschen. Sie demonstrieren für die griechischen Freiheitskämpfer, genauso enthusiastisch wie jemals die demonstrierenden Arbeiter bei uns, die dann von den galoppierenden Pferden der Polizei niedergetrampelt wurden. Wie lange ist das her… hier kommen jetzt die Jeeps mit Getöse an, die Stimmen der jungen Leute verklingen, und diese große janusköpfige Stadt schläft wieder ein, driftet in einen dumpfen Schlaf wie ein verstörter Patient, dem man zur Schlafenszeit ein Schlafmittel verabreicht hat.
*
Ausländer speisen oben auf dem Wolkenkratzer namens Hochhaus. Gegen Währung. Das Essen schmeckt viel besser als die Gerichte, die ich an allen möglichen Orten probiert habe. Die Menschen hier sind äußerst elegant. Das fällt ins Auge, denn auf den Straßen sind alle Menschen fast grau. Den Unterschied zwischen den bunt und frisch gekleideten Passanten zu Hause und der schäbigen Kleidung der Wiener empfanden wir zunächst deprimierend groß. Nun trägt man hier gut geschnittene Herren- und Damenkleidung. Sie sind hübsch und elegant. Einige von ihnen sind sogar fett.
Dicke Menschen werden auf der Straße genau beobachtet. Jeder, der zunehmen konnte, ist verdächtig. Denn hier sind alle dünn. Am Marsch zum 1. Mai nahmen viele Kinder teil. Blasse, dünne kleine Dinger. Etwa fünfzig von ihnen saßen in einem Wagen unter einem großen Schild: „Prinz Starhemberg hat seine drei Schlösser zurück, aber wir haben kein Zuhause!“ Österreicher hungern und sind obdachlos in ihrem eigenen Land. Die kommunistische Arbeiterschaft, deren Zahl von Tag zu Tag wächst, hat nur vier Vertreter. Man lässt keine Neuwahlen zu, mit der Begründung, dass die Kommunistische Partei keine Neuwahlen wollen kann, weil sie nur eine Zwergpartei ist. Dabei marschierten sie stundenlang in einer dichten Kolonne unter riesigen Bannern die breite Fahrbahn des Rings entlang. Mit der „Zwergpartei“ zogen die Fabrikarbeiter, die uniformierte Armee der öffentlichen Versorgungsbetriebe und alle, die sich getraut haben. Die winkende, jubelnde Menge auf beiden Seiten wagte es nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie hatten Angst. Aber wenn es saubere Wahlen gäbe, wüssten sie, wo sie das Kreuz setzen sollen. Die Dosen, die sie bei sich trugen, die Schilder, mit denen sie gegen die „Spenden“ des Marshallplans protestierten, wurden überall bejubelt. Diese Spalierstehenden und Demonstranten speisen nicht im Hochhaus und sie essen sowieso nicht viel. Sie haben jahrelang gehungert und fast schon vergessen, was gut ist. Ein Stück Kuchen – wenn auch ohne Zucker zubereitet –, eine Tasse schwarzer Kaffee mit einem Stück Saccharin aus der kleinen Tüte des Kellners, das ist ein Fest. Der Kaffee hat nichts im Geringsten mit Bohnenkaffee zu tun.
Gutes Essen gibt es nur im Hochhaus, aber davon essen sie nicht. Und sie können auch keine Kleider, keinen Schmuck und kein feines Porzellan aus den Schaufenstern der Innenstadt kaufen, wo große Schilder verkünden: „Nur gegen Währung.“ Als ich das erste Mal ein solches Schild sah, hielt ich nach einem Polizisten Ausschau. Ist so etwas möglich? Wo ist die Wirtschaftspolizei? Hier wird das Volk verraten! Aber alle gingen ihren Weg weiter, die eine oder andere Frau blieb vor einem Schaufenster stehen, sah sich ein hübsches Kleid an und schritt dann weiter. Es ist nur für uns Ungarn seltsam, sie scheinen es gewohnt zu sein. Was schön und gut ist, ist für sie unerreichbar.
*
Die Opernaufführung ist herrlich. Edle Kulissen, eine wunderbare Harmonie in jedem Detail der Inszenierung. Gute Sänger, ein großartiges Orchester, ein ausgezeichneter Dirigent und ein begeistertes Publikum. Aber die Besucherzahlen der Oper, die nur noch im kleinen Theater aufgeführt werden kann, sind dennoch sehr gering. Im Erdgeschoss bleiben ganze Stuhlreihen unbesetzt und in den Logen herrscht gähnende Leere. Der Aufführung folgen Menschen, die auf der Tribüne der Trampelloge über Partituren kauern. Die Menschen in Wien haben kein Geld. Ich bemerke einen ernsthaften alten Herrn. Mit seinem kurzen weißen Bart sieht er aus wie ein Wissenschaftler, der gerade seine Bücherei verlassen hat. Er kontrolliert die Eintrittskarten. Und ich sehe auch einen hochgewachsenen jungen Mann, der mit einer leichten Verbeugung und einer zarten Handbewegung so höflich in Richtung des einzunehmenden freien Platzes zeigt, als würde er die Dame seines Herzens zum Tanz auffordern. Das, sagt eine ungarische Sängerin, die neben mir sitzt, sind Staatsbeamte. Sie können sich keine Eintrittskarten leisten, aber sie können nicht auf den Genuss der Opern verzichten. Also haben sie es auf sich genommen, als Platzanweiser zu arbeiten, um jeden Abend hier sein zu können.
*
Das riesige Kino ist bis auf den letzten Platz gefüllt. In den Reihen sitzen meist fortschrittliche Ungarn, aber auch viele deutschsprachige Österreicher. Deshalb wird der ungarischsprachige Film, der jetzt gezeigt wird, auf Deutsch erklärt: Der Film „Irgendwo in Europa“ läuft an. Es herrscht eine tiefe Stille, man kann die Spannung der Aufmerksamkeit der Menschen spüren, es ist, als wären wir durch elektrischen Strom verbunden. Die Szenen werden mehrmals durch Beifall unterbrochen. Aber es ist schon seltsam: Haben sich die Leute hier erkältet, oder was mag passiert sein? Man räuspert sich und schnäuzt sich die Nase. Als das Licht wieder angeht, wischt sich ein stämmiger, kräftiger Mann, der neben mir sitzt, beschämt die Augen. Als er bemerkt, dass ich ihn ansehe, versucht er sich verlegen zu rechtfertigen: „Sie sehen ja, auch wenn man weit weg von der Heimat ist…“
Ich beobachte die Menschen. Es ist nicht zu leugnen, dieses Publikum hat geweint. Die Frauen wischen sich offen die Augen und erheben sich von ihren Sitzen mit gerührter, erweichter Miene. Der Film war ein durchschlagender Erfolg und wird sicherlich noch lange in aller Munde sein. Er hat ihr Verständnis durch Liebe erreicht, und das bedeutet hier, wo es nur wenige lehrreiche neue Stimmen gibt, sehr viel.
*
Es gibt einen kleinen Laden in einer abgelegenen Straße. Hier werden Bananen verkauft. Ich bleibe vor dem Schaufenster stehen. Die Tür ist verschlossen, der Besitzer ist wahrscheinlich beim Mittagessen. Ein Mann und eine Frau kommen an, die Frau drückt auf die Türklinke und wendet sich wütend an ihren Begleiter: „Er ist nicht mehr hier, dieser Mensch macht auf, wenn es ihm danach ist. Heute werden wir wieder keine Bananen essen.“ Ich werde neugierig, denn sie sprach in prächtigem Ungarisch, in gutem Pester Dialekt, außerdem ist sie sehr elegant und trägt viele Armbänder; so mache ich mich auch auf den Weg, als sie weitergehen. Ich muss ihnen nicht lange folgen, sie betreten bald ein Café. An jedem Tisch sitzt schon jemand, ich kann kaum einen Platz bekommen. Ungarische Wörter schwirren um mich herum. Es ist, als wäre man in Pest. Aber der Unterschied wird bald deutlich werden. Am Tisch neben mir unterhalten sich zwei Personen. „Und wie sieht es zu Hause aus? Man kann ja wegen dieser Bastarde nicht einmal nach Hause gehen.“ „Zu Hause, zu Hause… Eine Augenwischerei ist das, mein Freund. Die Schaufenster sind voll. Weißt du, meine Tochter und ihr Mann haben einen Großhandel, aber sie werden fast verrückt. Seit diesem kleinen Vorfall werden sie von der Wirtschaftspolizei ständig beobachtet…“ „Und war deine Reise denn erfolgreich?“ „Ich konnte zwei Zentner Hanf kaufen. Aber ich habe sie sofort weiterverkauft.“ „Hast du damit etwas verdient? „Nun ja… ich könnte einen Dritten kaufen. Aber man hat einfach keine Lust mehr. Wozu sollte ich mir die Mühe machen? Ich werde wieder hingehen, wenn ich den Gewinn ausgegeben habe. Mein Schwiegersohn kauft mir jetzt Dollars. Die werde ich rüberbringen.“
Der Kellner bringt sogar Zucker zum kleinen Schwarzen. Der Duft von echtem Bohnenkaffee schwebt über den Tischen. Die armen Menschen müssen hier schmachten, wegen dieser verdammten Demokratie. Dabei wäre es viel besser, in einer kleinen Espressobar in der Innenstadt von Pest zu sitzen…
Deutsch von Bernadett Modrián-Horváth
Bécs két arca. In: CSILLAG, 1947-48, H. 10, S. 41–44.