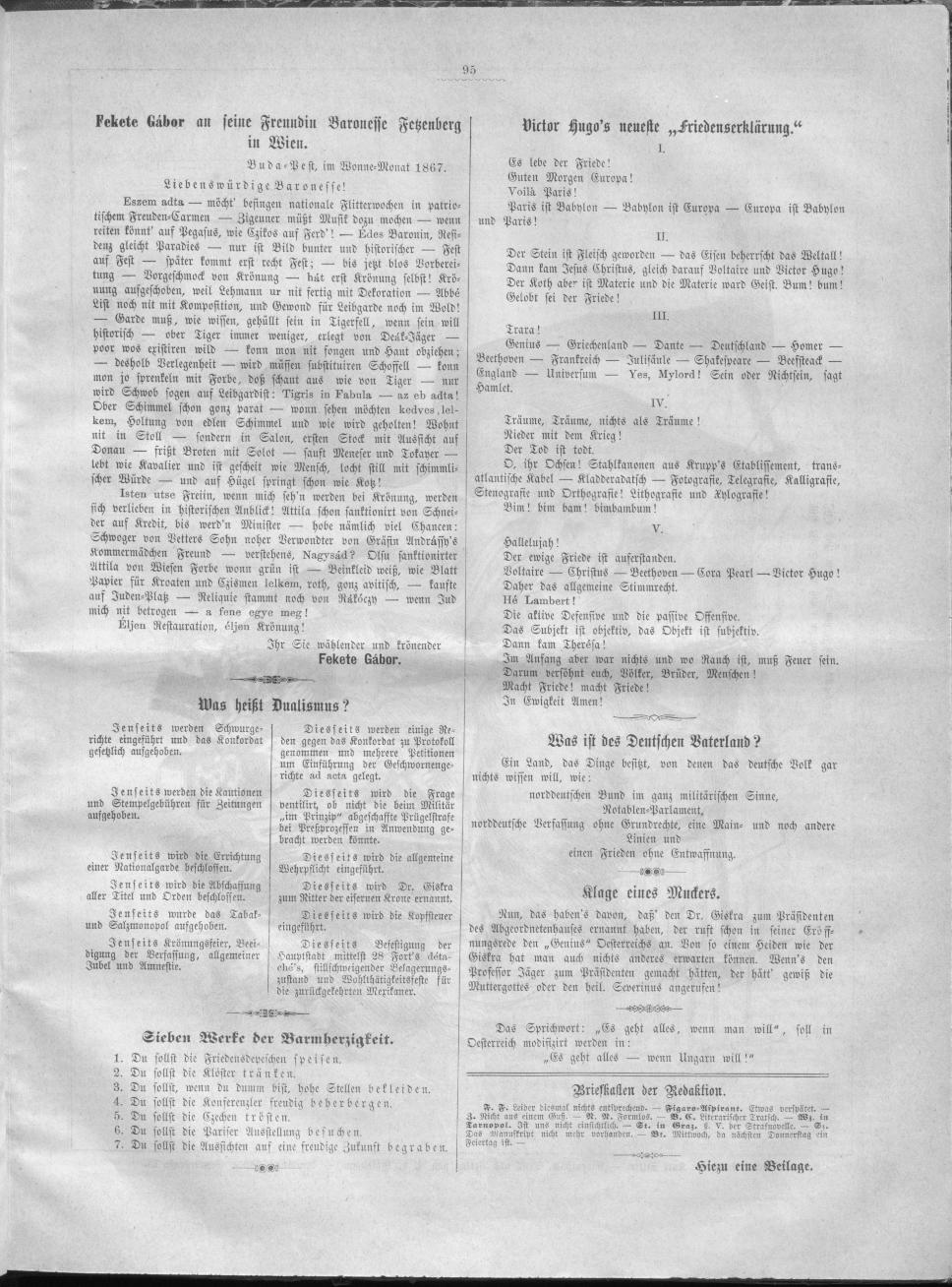Fekete Gábor an seine Freundin Baronesse Fetzenberg in Wien
- Autor*in: Adolf Kallay
- Übersetzt von: Gábor Fekete
- Publikationsdaten: Ort: Wien | Jahr: 1867
- Erschienen in: Figaro
- Ausgabe-Datum: 25. 04. 1867
- Entstehungsjahr: 1867
- Teile: Nr. 2 der Sequenz
- Originalsprachen: Deutsch
- Verfügbarkeit: Österreichische Nationalbibliothek
- Gattung: Erzählung
Kommentar:
Der am 25. April veröffentlichte fiktive Brief von Gábor Fekete wurde in Wirklichkeit von Dr. Adolf Kállay (1839-1899), einem ursprünglich jüdischen, in Ungarn (Ótura, heute Stará Turá in der Slowakei, unter dem Namen Kohn) geborenen Arzt geschrieben, der in den 1860er Jahren als ständiger Mitarbeiter der Figaro vor allem fiktive satirische Briefe verfasste, die bei den Lesern großes Gefallen fanden. Kállay war später als Franzensbader und darauffolgend als Karlsbader Brunnerarzt tätig, arbeitete als Herausgeber des Illustrierten Curorte-Almanachs (1887-1889) und des im April 1887 bereits in der 7. Auflage erschienenen Illustrierten Ärztlichen Almanachs.
In diesem Brief erzählt Gábor Fekete von einem ungeheuren Pomp und übertrieben groß angelegten Plänen zu den Krönungsfeierlichkeiten, die im Juni abgehalten werden sollen. In dem lustigen Bericht schreibt er über die eifrigen und pompösen Vorbereitungen, u.a. dass die Ungarn bei den Feierlichkeiten historische Ansichten heraufbeschwören wollen, z.B. die traditionelle festliche Bekleidung der Leibgarde soll mit Tigerfell geschmückt werden, aber mangels Tigerfells wird gefärbtes Schaffell verwendet. Die Äußerlichkeiten scheinen überaus wichtig zu sein, sogar für den fiktiven Autor des Briefes, der wolle nämlich für die Feier eine sogenannte Attila, den traditionellen Uniformrock der Husaren tragen, aber dieses Kleidungsstück wurde bereits „sanktioniert vom Schneider auf Kredit“, und nur Minister können Attila tragen. Aber auch Fekete habe zum Ministerposten eine Chance über unübersichtliche Kontakte zum Grafen Andrássy, dem ersten Ministerpräsidenten nach dem Ausgleich, womit Kállay auf die vermeintliche bestehende Vetternwirtschaft in der ungarischen Staatsverwaltung hinweist.
Die Erwähnung von Gyula Andrássy ist von großer Bedeutung in diesem Kontext, denn er gilt als Symbolfigur für die Versöhnung zwischen Österreich und Ungarn. Der Graf wurde nach dem Freiheitskampf 1849 zum Tode verurteilt, überlebte aber als Flüchtling in der Emigration und kehrte erst 1858 nach Ungarn zurück. 1867 erteilte Franz Joseph Amnestie für alle ab dem 1848 verübten Verbrechen des Hochverrats. Als Folge konnte die erste Regierung eben von Graf Andrássy, einem Aufständischen, geleitet werden. Die Versöhnung wurde einige Monate später auch mit dem Krönungsakt zeremoniell besiegelt, denn die Stephanskrone wurde Franz Joseph von Graf Andrássy aufgesetzt.