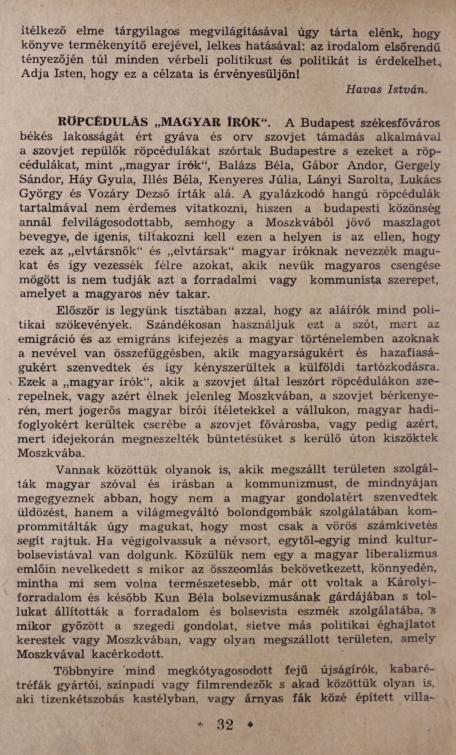„Ungarische Schriftsteller“ mit Flugblättern
- Autor*in: J. G.
- Übersetzt von: Bernadett Modrián-Horváth
- Publikationsdaten: Ort: Budapest | Jahr: 1942
- Erschienen in: Koszorú
- Ausgabe-Datum: 1942
- Originalsprachen: Ungarisch
- Gattung: Artikel
Übersetzung
J. G.: „Ungarische Schriftsteller“ mit Flugblättern
Während des feigen und hinterhältigen sowjetischen Angriffs auf die friedliche Bevölkerung der Haupt- und Residenzstadt Budapest warfen sowjetische Flugzeuge Flugblätter auf Budapest ab, die von Béla Balázs, Andor Gábor, Sándor Gergely, Gyula Háy, Béla Illés, Júlia Kenyeres, Sarolta Lányi, György Lukács und Dezső Vozáry als „ungarischen Schriftstellern“ unterzeichnet waren. Der Inhalt der verleumderischen Schmähschriften ist keinen Streit wert, das Budapester Publikum ist ja viel zu aufgeklärt, um der Lügerei aus Moskau aufzusitzen. Doch auch hier, an dieser Stelle müssen wir das Wort dagegen erheben, dass diese „Genossinnen“ und „Genossen“ sich als ungarische Schriftsteller bezeichnen und damit diejenigen irreführen, die hinter den ungarisch klingenden Namen nicht die Revolutionäre oder Kommunisten erkennen, die sich dahinter verbergen.
Zunächst sei klargestellt, dass es sich bei den Unterzeichnern ausschließlich um Ausreißer, um politische Flüchtlinge handelt. Wir verwenden diesen Ausdruck bewusst, denn die Begriffe „Emigration“ und „Emigrant“ sind in der ungarischen Geschichte mit dem Namen derer verbunden, die als Ungarn für ihre Heimat leiden mussten und gezwungen waren, im Ausland zu leben. Diese „ungarischen Schriftsteller“, die auf den von den Sowjets verbreiteten Flugblättern aufgeführt sind, leben derzeit entweder deshalb als Söldlinge in Moskau, weil sie als gerichtlich rechtskräftig Verurteilte gegen ungarische Kriegsgefangene getauscht und in die sowjetische Hauptstadt gebracht wurden, oder weil sie die ihnen drohende Strafe rechtzeitig witterten und auf Umwegen nach Moskau flohen.
Einige von ihnen dienten dem Kommunismus in den besetzten Landesteilen in Wort und Schrift, doch allen ist gemeinsam, dass sie die Verfolgung nicht für das ungarische Gedankengut erlitten, sondern sich im Dienste der bolschewistischen Welterlöser dermaßen kompromittierten, dass ihre einzige Rettung das rote Exil blieb. Beim Durchlesen der Namensliste sehen wir, dass wir es ausnahmslos mit Kulturbolschewisten zu tun haben. Mehrere von ihnen sind unter den Fittichen des ungarischen Liberalismus großgeworden. Als der Zusammenbruch kam, standen sie bereits, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, auf der Seite Károlyis und dessen Revolution und später unter den Bolschewisten von Béla Kun; sie stellten ihre Federn in den Dienst der bolschewistischen Revolution, und als die Gegenrevolution siegte, bemühten sie sich schnell um ein anderes politisches Klima, entweder in Moskau, oder auf einem besetzten Gebiet, das mit Moskau liebäugelte.
Meistens handelt es sich bei ihnen um übergeschnappte Journalisten, Witzemacher, Bühnen- oder Filmregisseure, und manch einer ist in einer Zwölfzimmervilla oder in einer schattigen Landresidenz aufgewachsen, um sich später in seinen Schriften gegen seine Erziehung, seine Vergangenheit und die soziale Schicht zu wenden, der er angehört hatte. Aber eins ist ihnen gemeinsam: Dass sie nichts mit dem Ungartum zu tun haben, weder blutsmäßig noch geistig, und dass sie heute noch in Moskau im Dienst des internationalen Bolschewismus stehen. Diese Gauner und ihre weiblichen Mitläuferinnen schämen sich nicht, das Publikum der ungarischen Haupt- und Residenzstadt als ihre „Brüder und Schwestern“ anzureden und sich ungarische Schriftsteller zu nennen. Man sollte über diese Dreistigkeit lachen, wären neben ihren Flugblättern nicht auch Bomben auf ungarische Gebiete gefallen, die ungarische Menschenleben auslöschten und ungarische Werte vernichteten. Jedenfalls werden wir auch diesen jüngsten „brüderlichen“ Auftritt von ihnen in ihr Sündenregister aufnehmen und, dessen können sie sicher sein, nicht vergessen.
Deutsch von Bernadett Modrián-Horváth
Röpcédulás „magyar írók”. In: Koszorú 1942/1, S. 32-33.